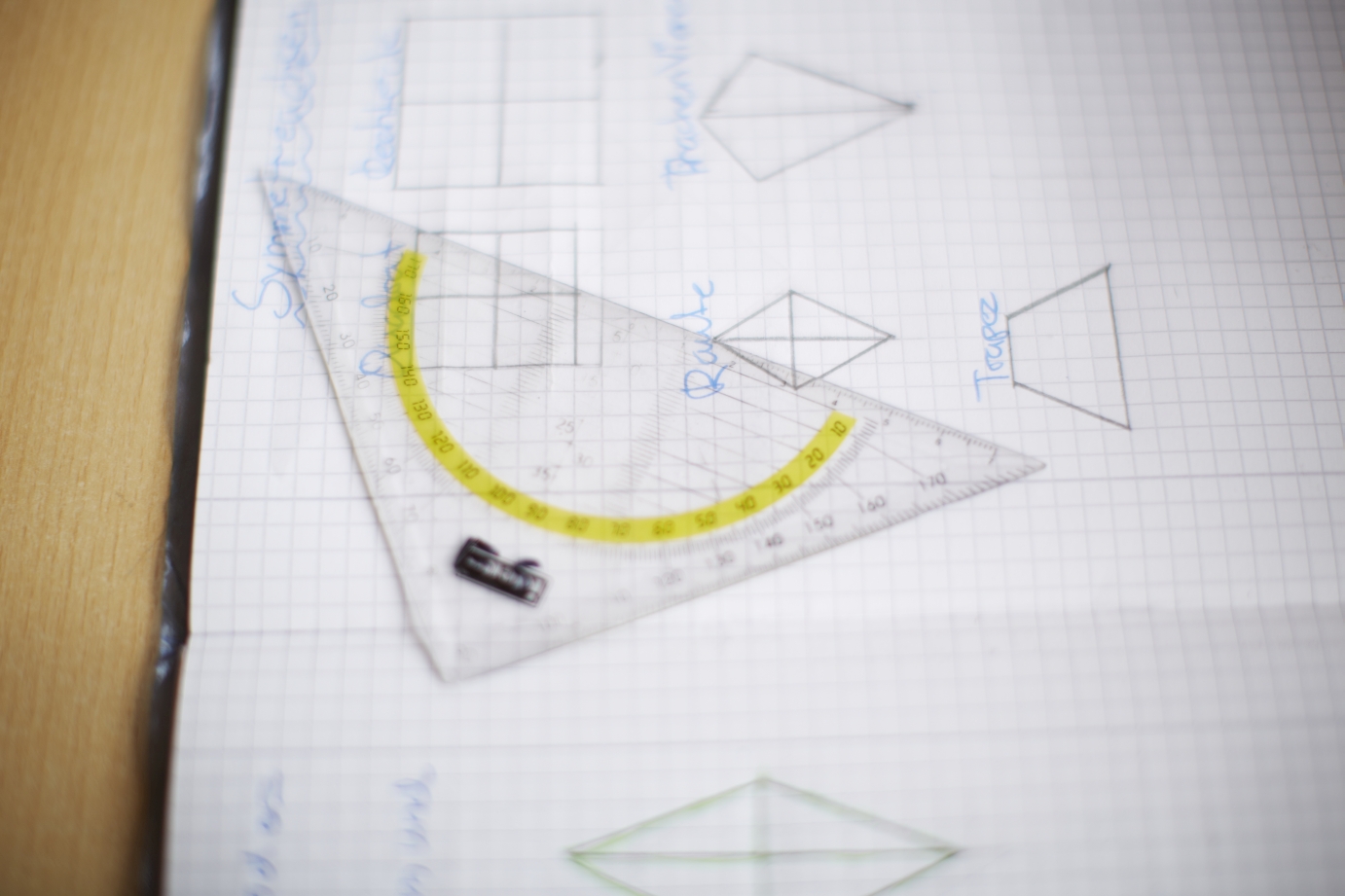Als im April bekannt wurde, dass in Hamburg der Vorabitur-Notenschnitt in Mathematik bei 4,1 lag, schlugen rund 130 Professoren und Mathematiklehrkräfte Alarm. Das mathematische Vorwissen vieler Studienanfängerinnen und -anfänger reiche nicht mehr für ein Studium der Mathematik oder der Technik- und Naturwissenschaften aus, hieß es in einem offenen Brief an die Kultusministerkonferenz (KMK), die Hochschulrektorenkonferenz (HRK), die Deutsche Mathematiker-Vereinigung (DMV) und das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB). Schuld an der Misere sei die Kompetenzorientierung im Schulunterricht. Die auf „kompetenzorientierte Standards“ bezogenen Tests, an denen sich mittlerweile auch der Mathematikunterricht orientiere, „prüfen unter dem Deckmantel Mathematik lediglich Alltagswissen ab, ohne fachlich in die Tiefe zu gehen“.
Mit dem Brandbrief der Mathematiker flammte ein seit gut 16 Jahren schwelender Konflikt unter Bildungsexperten neu auf. Eine der Konsequenzen aus dem schlechten Abschneiden Deutschlands bei der 2001 veröffentlichten ersten PISA-Studie war die Einführung von Bildungsstandards. Diese legen fest, welche Fähigkeiten und Kenntnisse in einer bestimmten Jahrgangsstufe in den Hauptfächern und den Fremdsprachen erreicht werden sollen. Durch die Vermittlung bestimmter Kompetenzen werden Schülerinnen und Schüler befähigt, die Bildungsstandards zu erreichen. Diese sind derweil umstritten. GEW-Schulexpertin Ilka Hoffmann gibt zudem zu bedenken, dass bei der Erarbeitung der Standards vom Gymnasialniveau aus gedacht werde. Es gebe kaum Forschungen dazu, wie beispielsweise mathematisches Verständnis im Förderschulbereich entwickelt werden könne.
Der komplette Artikel von Jürgen Amendt ist in der Dezemberausgabe der „E&W“ nachzulesen.